Wortwiederholungen sind nicht bloß eine Stilfrage

Eine rote Welle unter einem Wort und daneben, im Korrekturrand, der Vermerk »Wortwiederholung« – das ist ein Anblick, der mir während meiner Schulzeit das eine oder andere Mal aus meinem Deutsch-Schularbeits-Heft entgegengesprungen ist.
Vielleicht ist diese Erinnerung im Detail ein wenig verzerrt; Meine Reifeprüfung liegt schließlich auch schon 20 Jahre zurück und in Job und Studium habe ich, wenig überraschend, keine Deutsch-Schularbeiten mehr geschrieben. Vielleicht war es also keine gewellte Unterstreichung und vielleicht stand der Vermerk auch nicht im Korrekturrand, sondern im nicht-übertragenen Sinn zwischen den Zeilen. Fakt ist aber in jedem Fall, dass mir Wortwiederholungen das eine oder andere Mal angekreidet wurden.
Und dass mir diese Korrekturen ins Auge gesprungen sind, ist sicher auch ein Fakt, denn grundsätzlich hatte ich für Deutsch ein geschicktes Händchen. Hätt ich gehabt schlechtes Worte und Satz Grammatik mit vieles Buchstapierfehler, wäre mir so eine Wortwiederholung in der Flut von Korrekturen wahrscheinlich kaum aufgefallen – sofern der Lehrer sich dann überhaupt noch die Mühe gemacht hätte, so eine Lappalie anzuzeichnen. Ein Mechaniker interessiert sich ja auch nicht mehr für einen Wackelkontakt am Autoradio, wenn das Gefährt drumherum ein Totalschaden ist.
In jedem Fall ist bei mir hängen geblieben: Worte oder Phrasen beim Textschreiben ohne konkrete Absicht zu wiederholen, ist Zeichen eines uneleganten Schreibstils. Aber erst nach und nach ist mir so richtig bewusst geworden, wieso solche Wiederholungen auch aus praktischen Gründen schlecht für Texte sein können.
Wiederholungen sind gut
Wortwiederholungen sind nicht in jedem Fall schlecht. Obwohl ich selbst den Begriff »Wortwiederholung« ausschließlich mit seiner negativen Bedeutung in Verbindung bringe, spucken Suchmaschinen dazu vorwiegend das Gegenteil aus, nämlich Erklärungen dazu, wie Wiederholungen als rhetorisches Stilmittel Aussagen verstärken und Texte strukturieren können.
Als Martin Luther King seine berühmte Rede »I have a Dream« (»Ich habe einen Traum«) hielt und dabei acht Sätze hintereinander mit »I have a dream …« begann, lag das natürlich nicht daran, dass sein Vokabular zu beschränkt war. Er wollte ganz bewusst seine persönliche Vision für den »American Dream« präsentieren und hatte damit eine der einprägsamsten Reden der Geschichte gehalten.

Wiederholungen so gekonnt einzusetzen, gehört allerdings zur Meisterklasse der Sprachbeherrschung, die man wahrscheinlich in keiner Regelschule lernt. Ich kann zwar zugegeben nicht ausschließen, dass rhetorische Wiederholungen auch in meiner Schulzeit einmal erwähnt wurden, aber viel mehr als eine Randnotiz dürften sie wohl nicht gewesen sein. Aktiv geübt hatten wir ihre Anwendung jedenfalls nicht.
Allerdings will ich das meinen Lehrern auch gar nicht zum Vorwurf machen, schließlich taten sich in Deutsch nicht alle meiner Mitschüler so leicht wie ich. Ewig in Erinnerung bleibt mir unter anderem eine Hausübung am Gymnasium, in der wir Bildbeschreibungen verfassen sollten. Ein Kollege, gebürtiger Österreicher, hatte sich dabei an einer eleganten Passiv-Formulierung versucht und dabei den folgenden Satzunfall verbrochen: »Die auf ihren Köpfen tragenden Mützen haben auch schon staubgrau gefärbt.« Ein anderer Kollege hielt es in derselben Übung wiederum für angemessen, den Gesichtsausdruck einer alten Dame im Dialekt mit »zomzahts Gsicht« (»zusammengezogenes Gesicht«) zu beschreiben.
Da kann ich es schon nachvollziehen, wenn sich die Lehrer sagen: »Lassen wir das mit der künstlerischen Rhetorik lieber sein! Ich bin schon froh, wenn die Schüler unfallfrei zehn Wörter aneinanderreihen können und nicht jeden Satz mit dem gleichen Wort beginnen.«
Ich als Erbsenzähler, der Regeln oft viel zu streng auslegt, hatte dadurch allerdings lange Zeit viel zu verkrampft versucht, selbst über längere Text-Distanzen Wortwiederholungen zu vermeiden. Das hatte nicht selten sperrige Umschreibungen und absurd weit hergeholte Verallgemeinerungen zur Folge. Da konnte ein Tisch durchaus zur »Ablage-Vorrichtung mit vier Beinen« oder zum »Einrichtungsobjekt« werden … und ein eigentlich ernst gemeinter Text klang plötzlich ungewollt albern, weil ich die simpelsten Dinge nicht beim Namen nennen wollte. Das wurde mir – soweit ich mich erinnern kann – allerdings nie angekreidet.
Wiederholungen als unnötiges Füllmaterial
Zumindest bei kürzeren Text-Distanzen ergibt es durchaus Sinn, Wortwiederholungen zu kritisieren, wenn man durch eine Umformulierung die Mehrfachnennung komplett vermeiden könnte. »Der Tisch ist braun. Der Tisch hat vier Beine«, lässt sich zusammenfassen zu »Der Tisch ist braun und hat vier Beine.« So kann man mit weniger Worten genauso viel aussagen und kommt gar nicht erst in die Versuchung, sich abenteuerliche Synonyme oder Umschreibungen aus den Fingern zu saugen.
In diesem Beispiel ist das natürlich trivial, aber nicht immer ist die Lösung so offensichtlich. Betrachten wir etwa folgendes Satzpaar: »Tisch und Sessel sind aus Eichenholz gefertigt. Der Tisch hat eine Höhe von 75 Zentimetern.« Hier kann man nicht einfach beide Sätze mit einem Und verbinden und die zweite Tisch-Nennung streichen, weil man klarstellen muss, ob sich die Höhe auf den Tisch oder auf den Sessel bezieht. Aber man könnte zum Beispiel noch knapper umformulieren zu: »Der Sessel und der 75 Zentimeter hohe Tisch sind aus Eichenholz gefertigt.«
Auch durch den Einsatz von Pronomen lassen sich oft Wortwiederholungen vermeiden und Texte kürzen. Die deutsche Sprache strotzt nur so vor langen Wort-Ungetümen, aber die Fürwörter »er«, »sie« und »es« könnten kaum kürzer sein. Beim »Tisch« macht das zugegeben nicht viel Unterschied, aber wenn man das Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz in Folgesätzen einfach nur »es« nennen darf, ist das schon ein Segen.
Praktisch an den langen, zusammengesetzten Hauptwörtern der deutschen Sprache ist aber immerhin, dass man sie bei der wiederholten Verwendung auch einfach abkürzen kann. Liegt die Erwähnung des Gesetzes mit dem wahrscheinlich längsten Namen der Welt schon zu weit zurück, um es noch mit »es« referenzieren zu können, kann man auch alle Wortbestandteile bis auf den letzten weglassen und es schlicht »das Gesetz« nennen.
Je nach Kontext kann man sich sogar die Frage stellen, ob ein häufig verwendeter Begriff überhaupt notwendig ist. Während Martin Luther King in seiner Rede ständig vom Träumen geredet hatte, kommt dieses Wort in meinem Traumtagebuch praktisch gar nicht vor, weil dort ohnehin selbsterklärend ist, dass sich alles auf Träume bezieht.

Wiederholungen und Mehrdeutigkeiten
Ein weiterer Grund, warum das Wort »Traum« in Martin Luther Kings Rede und in meinem Traumtagebuch unterschiedlich viel Gewicht hat, liegt darin, dass es mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet wird. Luther King meint damit im metaphorischen Sinn einen Wunsch beziehungsweise eine Vision. In meinem Traumtagebuch wäre es dagegen eine emotionslose Tatsachenbeschreibung. Ich hatte bloß im Schlaf gesehen, aber mir definitiv nie gewünscht, dass mir ein mumifizierter Pharao in einem Turnsaal eine Armbanduhr verkaufen will.
Solche Mehrdeutigkeiten von Begriffen können manchmal zu einer besonders heimtückischen Sorte von Wortwiederholungen führen, nämlich zu solchen, wo man rein zufällig zwei Mal das gleiche Wort verwendet, obwohl man unterschiedliche Dinge meint. Ein Beispiel wäre: »Er zählt sein Geld. Jetzt zählt für einen rechtzeitigen Kauf jede Minute.«
Heimtückisch ist so etwas deshalb, weil es zwei ungünstige Eigenschaften miteinander kombiniert:
- Als Leser kommt man bei der Wortwiederholung eventuell ins Stocken, weil man aufgrund der vorigen, anders gemeinten Nennung erst einmal eine falsche Bedeutung hineinliest.
-
Als Autor übersieht man die Wortwiederholung leicht, weil man weiß, dass man zwei unterschiedliche Dinge meint und daher keine Verbindung zwischen den oberflächlich identischen Wörtern herstellt.
Aus Gründen wie diesem wird auch empfohlen, Texte nicht sofort nach dem Schreiben zu veröffentlichen, sondern erst ein wenig ruhen zu lassen und noch einmal gegenzulesen, sobald man etwas Abstand davon gewonnen hat.
Noch heimtückischer und leichter zu übersehen ist die Variante, bei der zwei Begriffe nicht gleich sind, sondern bloß in einer von mehreren Deutungsweisen in den gleichen Kontext fallen; wenn es also beispielsweise heißt: »Er hat eine beträchtliche Menge Bargeld abgehoben. Auf der Bank, die im nahegelegenen Park steht, zählt er zur Sicherheit noch einmal die Scheine nach.« Aber das ist definitionsgemäß keine Wortwiederholung mehr und daher nicht Kern dieses Artikels.
Wiederholungen und Konkretisierungen
Mehrdeutige oder vage Begriffe können auch in anderer Hinsicht zu Verständnisproblemen führen – nämlich dann, wenn aus dem Kontext nicht ersichtlich ist, welche der möglichen Bedeutungen man meint. Hier kann es das Textverständnis erhöhen, wenn man ein und dieselbe Sache bei mehreren Namen nennt.
Nehmen wir folgende Wegbeschreibung als Beispiel: »Folgen Sie diesem Weg, bis Sie auf der rechten Straßenseite eine Bank sehen! Nach dieser Bank müssen Sie rechts abbiegen.« Hier wäre nicht klar, ob ich nach einem Geldinstitut oder nach einer Sitzgelegenheit Ausschau halten soll. Stünde im zweiten Satz nicht noch einmal »Bank«, sondern »Geldinstitut« oder »Sitzgelegenheit«, wäre es unmissverständlich.
Ein schwieriger Fall in dieser Hinsicht war mein Artikel über Tabs im Dateimanager. Das Ding, über das ich dort schreibe, hat zwei Namen, aber beide haben mehrere Bedeutungen:
- Tab: Kann auch ein Geschirrspülmittel oder eine Abkürzung für die Tabulator-Taste auf der Tastatur, sowie das von ihr erzeugte Zeichen, sein.

Tab oder Tab? - Reiter: Kann auch eine Person sein, die auf einem Pferd, Kamel, Delphin oder Mammut reitet.
Da ich auf WIESOSO über einen Themen-Mix von Computersprachen bis zu Klopapier schreibe, könnte man nicht ausschließen, dass ich mich in einem Artikel mit Geschirrspülern oder Reiterei beschäftige. Indem ich schon im Titel und im Anreißer beide Begriffe parallel verwende, sollte aber schnell klar werden, dass Tabs beziehungsweise Reiter von Registerkarten gemeint sind. Ein Artikel über die Bedienung von Geschirrspülern, während man auf einem Pferd sitzt, wäre schließlich selbst für meine Verhältnisse etwas zu speziell.
Wiederholungen und Exotenstatus
Wie sehr eine Wortwiederholung ins Auge springt, hängt natürlich auch davon ab, wie augenspringend das Wort schon für sich allein ist. Wenn ich in einem einzigen Satz mehrmals den Artikel »der« verwende, wird der, der der deutschen Sprache mächtig ist, mir das nicht übelnehmen. Auch »Tisch« ist noch ein relativ unscheinbares Wort, das ich bisher nur zur Veranschaulichung verwendet hatte. Wenn ich aber Wort-Exoten verwende und diese Wort-Exoten wiederhole, sind diese wiederholten Wort-Exoten schwer zu übersehen.
Je seltener ein Begriff ist, desto mehr Aufmerksamkeit erfordert es, ihn zu lesen und zu verstehen. Im schlimmsten Fall kennt der Leser den Begriff überhaupt nicht. Wenn das entsprechende Wort oder die Phrase dann auch noch ohne ergänzende Informationen wiederholt wird, fühlt man sich als Leser erst recht vor den Kopf gestoßen.
Mir ging es letztes Jahr einmal so, als ich über einen Online-Artikel mit dem folgenden Titel gestolpert war: »Australien: 17 Jahre Haft wegen Sextortion, 180 Minderjährige unter den Opfern« Weil mir das Wort »Sextortion« nicht geläufig war, hatte ich auch den Anreißer gelesen, um meinen Wortschatz zu erweitern. Aber dort wurde das Wort nur nochmals ohne Erklärung wiederholt. Also öffnete ich den Artikel, las den ersten Satz … und bekam zum dritten mal ohne jede Klarstellung den gleichen Begriff serviert.
Gerade bei solchen Fachausdrücken bietet es sich deshalb an, ab der zweiten Erwähnung auch Synonyme und Umschreibungen zu verwenden, statt wie eine kaputte Schallplatte immer nur das gleiche Wort abzuspielen. Hätte man »Sextortion« im Anreißer durch »sexuelle Erpressung« ersetzt, hätte ich wesentlich schneller verstanden, worum es geht.
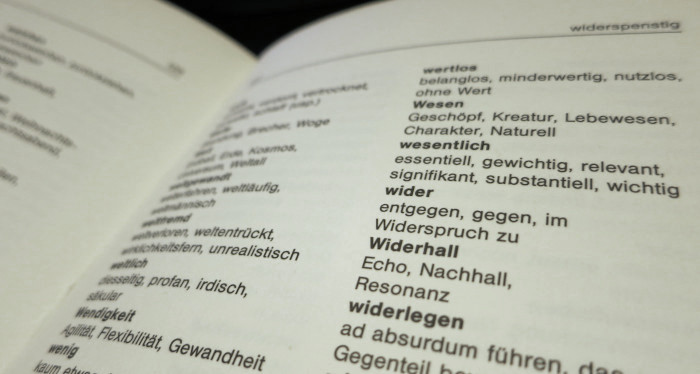
Natürlich hätte ich als Leser auch auf Wikipedia oder sonst wo nachschlagen können, aber so brennend hatte mich das Thema wirklich nicht interessiert. Und als Autor darf man sich in der Regel auch nicht so viel Engagement von seiner Zielgruppe erwarten – schon gar nicht im Internet, wo der nächste Artikel immer nur einen Klick entfernt ist. Wer mir in den ersten drei Sätzen nicht einmal vermitteln kann, worüber er eigentlich redet, hat meine Aufmerksamkeit vollkommen zurecht verloren.
Zugegeben gibt es natürlich keine klar definierte Grenze zwischen allgemein bekannten Wörtern und erklärungsbedürftigen Fachausdrücken. Je nach Zielgruppe kann es sogar vorkommen, dass ein gehobener Ausdruck der verständlichere ist. So werden wahrscheinlich viele Leute mit nicht-deutscher Muttersprache das Fremdwort »Rotation« intuitiver verstehen als »Drehung«, weil es »Rotation« auch im Englischen und in mehreren romanischen Sprachen gibt.
Wenn aus dem Kontext klar hervorgeht, dass beide Male das Gleiche gemeint ist, spielt es gar keine Rolle, welches der beiden Wörter einem unbekannt ist. Wer nur »Rotation« kennt, kann sich damit »Drehung« erklären, und wer nur »Drehung« kennt, kann sich damit »Rotation« erklären. Nur dann, wenn man auf Synonyme verzichtet und stattdessen auf Wortwiederholungen setzt, stößt man eine dieser beiden Gruppen vor den Kopf.
Wiederholungen und Zielgruppen
Allen Unkenrufen zum Trotz sind Wortwiederholungen – auch solche ohne rhetorische Finesse – bei manchen Zielgruppen unvermeidlich.
So wird zum Beispiel für Einfache Sprache vorgeschrieben, immer die gleichen Wörter zu verwenden. Als weitere Regel wird hier aber natürlich auch voraussetzt, dass die verwendeten Wörter der Leserschaft bekannt sind. Insofern muss man bei nicht-trivialen Themen erst recht einige Begriffe nach ihrer ersten Erwähnung mit anderen Worten umschreiben, bevor man sie wiederholen darf.
Wenn man Begriffe im Wörterbuch- oder Lexikon-Stil erklärt, riskiert man im Gegenzug aber auch, Leser, die diese Definitionen nicht benötigen, zu verärgern. Vor allem im Internet erwarten sich die meisten, schnell zum Kern der Sache zu kommen. Wer nach Erklärungen zu einer konkreten Funktion in LibreOffice Writer sucht, dann aber erst einmal erklärt bekommt, was LibreOffice Writer ist, fühlt sich nicht nur um seine Zeit betrogen, sondern mit seinem Anliegen auch nicht ganz ernst genommen.
Wortwiederholungen durch Synonyme zu vermeiden, ist dagegen eine Möglichkeit, Unwissenden unter die Arme zu greifen, ohne die Wissenden vor den Kopf zu stoßen. Wenn ich LibreOffice Writer nach der ersten Erwähnung »Textverarbeitungsprogramm« nenne, habe ich den Begriff in aller Kürze erklärt, ohne meinen Lesern indirekt Unwissen zu unterstellen – schließlich könnte die vermiedene Wortwiederholung auch eine rein stilistische Entscheidung sein.
Ist das ein vollwertiger Ersatz für eine einfach verständliche Wörterbuch-Definition? Nein. Aber es ist ein Kompromiss, der nicht nur die Unwissenden bedient.
So richtig definitionsfixiert, aber im Gegensatz zur Einfachen Sprache ganz und gar nicht einfach, sieht Juristendeutsch aus. Hier müssen Fachbegriffe klar definiert und danach konsequent verwendet werden, damit es möglichst wenig Spielraum für Interpretationen gibt.
Was nicht explizit definiert ist, wird zumindest mit überausführlichen Wortschöpfungen umschrieben. So gibt es etwa in der deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) keine »Ampeln«, sondern bloß »Lichtzeichenanlagen«. Verkehrssünder können sich also nicht darauf ausreden, das Gesetz irrtümlich auf Blumenampeln bezogen zu haben.
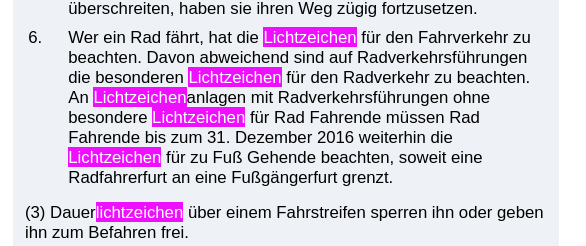
Wenn es wirklich nur darum geht, konkrete Inhalte unzweideutig zu vermitteln, sind solche Wörterbuch-Definitionen und Umschreibungen in Kombination mit konsequenten Wortwiederholungen wahrscheinlich die bessere Alternative beim Schreiben – auch, wenn der Text dadurch länger wird und man gegebenenfalls öfters hin- und herblättern muss, um die Definitionen nachzuschlagen.
Unterhaltsames Lesematerial, mit dem man sich abends ins Bett legt, sieht aber sicher anders aus. Das sollte neben trocken vermittelten Sachinhalten dann doch auch stilistisch ein bisschen etwas hergeben.
Artikel-Informationen
Artikel veröffentlicht:
Der monatliche WIESOSO-Artikel per E-Mail
Hat Dir dieser Text gefallen und würdest Du in Zukunft gerne per E-Mail über neue WIESOSO-Artikel auf dem Laufenden bleiben? Dann ist die WIESOSO-E-Mail-Gruppe genau das Richtige für Dich!

Kommentare
Neuen Kommentar schreiben
Bisherige Kommentare
MM
Man könnte auch die wahrscheinlich längste Gesetzesbezeichnung der Welt ein einziges Mal ausschreiben und danach seine Abkürzung (RflEttÜAÜG) verwenden.
"Rad Fahrende" und "Zu Fuß Gehende". Hier sind unsere bundesdeutschen Nachbarn wieder einmal Weltmeister in der Formulierung geschlechtergerechter Sprache.